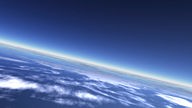Unser Wetter
neuneinhalb – für dich mittendrin. 02.09.2023. 01:42 Min.. UT. Verfügbar bis 02.09.2028. Das Erste.
Klima
Geschichte der Wettervorhersage
Früher war es überlebenswichtig, das Wetter vorhersagen zu können – doch es gab noch keine ausgefeilten Instrumente dafür. So lernte der Mensch, die Zeichen in der Natur zu deuten: zum Beispiel Wolken, Wind und das Verhalten der Tiere.
Von Andreas Kohler
Wettervorhersage und Bauernregeln
Schon vor Jahrtausenden wussten die Menschen, dass bestimmte Zeichen in der Natur ihnen bei der Wettervorhersage helfen konnten. Tau am Morgen zum Beispiel deutet auf einen sonnigen Tag hin. Wenn sich Ameisen plötzlich verkriechen, kann das dagegen schlechtes Wetter bedeuten.
Spätestens seit dem Mittelalter gibt es solche Wetterformeln auch in gereimter Form: als so genannte "Bauernregeln". Einige Beispiele:
- Morgentau macht den Himmel blau.
- Ist der Winter kalt und weiß, wird der Sommer lang und heiß.
- Regnet es am Siebenschläfertag, der Regen sieben Wochen nicht weichen mag.
- Bringt der Juli heiße Glut, gerät auch der September gut.
Seit der Neuzeit werden Bauernregeln auch gesammelt und erforscht.
Wolken als Wetterzeichen
Auch die Form und Dichte von Wolken ist ein Zeichen dafür, wie sich das Wetter entwickeln wird.
Die Wissenschaft ordnet Wolken in zehn verschiedene Gattungen ein, die in drei verschiedenen Höhenlagen vorkommen:
- hohe Wolken befinden sich in fünf bis 13 Kilometern Höhe, das sind zum Beispiel Cirruswolken
- mittelhohe Wolken in zwei bis sieben Kilometern Höhe, zum Beispiel Altocumuluswolken
- und tiefe Wolken in weniger als zwei Kilometern Höhe, zum Beispiel Stratuswolken.
Hohe Cirruswolken deuten auf eine Warmfront mit Regen hin, mittelhohe Altocumuluswolken dagegen sagen beständiges Wetter vorher.

Altocumuluswolken kündigen beständiges Wetter an
Daneben gibt es auch Wolkenarten, die sich über alle Höhenlagen erstrecken. Die bekannteste und imposanteste davon ist die Cumulonimbuswolke: Wenn sie sich am Himmel aufbaut, dann weiß auch der Wetterunkundige, dass ein schweres Unwetter auf ihn zukommt. Mehr als zehn Kilometer Höhe sind bei Cumulonimbuswolken bei uns nicht ungewöhnlich.
Erste Instrumente zur Wetterbeobachtung
Schon im 4. Jahrhundert vor Christus verfasste der griechische Philosoph Aristoteles die Abhandlung "Meteorologica", in der er atmosphärische Erscheinungen beschrieb. Seit der Neuzeit konnte die Naturwissenschaft mit ihren neuen Beobachtungsmethoden und Systematisierungsmöglichkeiten daran anknüpfen – langsam entwickelte sich die Wissenschaft vom Wetter (Meteorologie).
Dafür wurden auch neue Instrumente entwickelt: Das Thermometer gibt es seit Ende des 16. Jahrhunderts. Im 17. Jahrhundert entwickelten italienische Ingenieure das Barometer, mit dem sich der Luftdruck messen lässt.
Das erste moderne Hygrometer zur Messung der Luftfeuchtigkeit wurde Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich vorgeführt: Es funktionierte mit einem Frauenhaar und nutzte die Tatsache aus, dass sich Menschenhaar – wie Tierfell – bei steigender Luftfeuchtigkeit ausdehnt. Mit solchen Haaren funktionieren auch Wetterhäuschen, die bis heute in vielen Wohnstuben stehen.

Das Thermometer gibt es seit dem 16. Jahrhundert
Beginn der modernen Wettervorhersage
Die Erfindung des Telegrafen in der Mitte des 19. Jahrhunderts ermöglichte zum ersten Mal einen schnellen Austausch von Wetterdaten, die an verschiedenen Orten gesammelt wurden. Selbst von Schiffen aus, also auf dem offenen Meer, konnten nun solche Daten erfasst werden.
Neben der Messung von Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit werteten Forscher nun systematisch Windrichtung und -geschwindigkeit, den Grad der Bewölkung, Wolkenhöhe, Sichtweite sowie Menge und Beschaffenheit des Niederschlags aus.
Im 20. Jahrhundert verließ die Wetterbeobachtung den Erdboden: Spezielle Bojen nehmen inzwischen Daten überall in den Ozeanen auf, Wettersonden an Ballons oder Flugzeugen sammeln Messwerte in großer Höhe, Satelliten machen vom Weltraum aus Fotos von Wolken- und Windsystemen und Radarstationen zeigen an, wo Niederschläge aus den Wolken fallen.
Computer erleichtern den Meteorologen eine Interpretation dieser Daten. Das Internet hat deren Austausch noch einmal beschleunigt. Fast eine Woche im Voraus kann die moderne Meteorologie heute angeben, wie an verschiedenen Punkten auf der Erde das Wetter wird, mit einer Prognosegenauigkeit um die 90 Prozent.
(Erstveröffentlichung 2007. Letzte Aktualisierung 19.03.2020)
Quelle: SWR